Projektinhalte
Präsentation neuester Teilergebnisse an der RWTH Aachen
Zum Jahresende 2017 hatte die RWTH Aachen die Partner des SLAM-Förderprojektes zu einer zweitägigen Veranstaltung eingeladen. Es wurden Ergebnisse präsentiert, es wurde diskutiert und die weiteren Aktivitäten geplant. Nach einem ersten Tag im Kreise der SLAM-Konsortialpartner hatten am zweiten Tag auch assoziierte Partner die Möglichkeit zum Austausch über den aktuellen Stand des Projektes.
Unter anderem hat die Universität Stuttgart Zwischenergebnisse zur Untersuchung der Geschäfts- und Betreibermodelle vorgestellt, seitens BMW gab es einen Bericht zu den Untersuchungen von eRoaming und Ad-hoc-Laden, und Volkswagen stellte den Prototyp eines „Golden Test Device“ (GTD) als „Live“-Demo vor. Auch die RWTH Aachen und der DG VERLAG präsentierten ihre aktuellen Ergebnisse zum Lade-Standorttool, zur Nutzerbefragung und zum Referenzaufbau von Schnellladeinfrastruktur.
AP 1.3: Prototypische Umsetzung eines Simulationstools
Eine elementare Aufgabe des Forschungsprojektes SLAM ist der Know-How Aufbau für eine nachhaltige flächendeckende Ladeinfrastruktur. Dafür ist langfristig nicht nur die Anzahl von Schnellladestationen ausschlaggebend, sondern auch deren Platzierung.
Das im Projekt SLAM entwickelte Standortfindungsmodell STELLA nutzt Methoden und Datenstrukturen ähnlich zu Verfahrensweisen aus dem Bereich der Verkehrsmodellierung. Die Ausgabe des Modells stellen Ladebedarfe für Elektromobilität dar, die in Standortpotentiale für elektrische Ladeinfrastruktur überführt werden. Eine Skalierung sowohl der Eingangs- als auch der Ausgabeparameter, je nach betrachteter Fragestellung, ist durch den modularen Aufbau möglich. Innerhalb der Modellierung wurden mehrere Indikatorgruppen einerseits zur Beschreibung und andererseits zur räumlichen Verortung der täglichen Mobilität der Bevölkerung in einem spezialisierten, deutschlandweiten Verkehrsmodell zusammengestellt. Das Nutzerverhalten, die Verteilung von Fahrzeugen, die bereits existierende Ladeinfrastruktur sowie Raumstrukturen und die vorhandenen verkehrlichen Infrastrukturen bilden dabei die Grundlage für die weiteren Berechnungsschritte. Das darauf beruhende primäre Modellierungsergebnis des STELLA-Ansatzes beschreibt für jedes Stadtquartier des gesamten Planungsgebietes „Deutschland“ das Potential der zu erwarteten Ladungen in Abhängigkeit von benötigter Ladeleistung und erwarteter Aufenthaltszeiten.
AP 1.5: Softwareentwicklung für ein Simulationstool zur Standortdefinition
Im Rahmen des nationalen Forschungsprojekts SLAM wurde an der RWTH Aachen University ein öffentlich zugängliches Planungswerkzeug entwickelt und umgesetzt, um die geografischen Potenziale von Standorten für Schnellladeinfrastruktur (SLIS) in Deutschland zu berechnen. Bei der Berechnung von Standortpotenzialen werden zwei Submodelle berücksichtigt: Zum einen das Metropolmodell, bei dem die Attraktivität von Standorten und die Passung zur jeweiligen Aufenthaltsdauer im Vordergrund stehen; zum anderen das Achsenmodell, bei dem die Reichweitenvergrößerung der Elektrofahrzeuge und die größere Abdeckung des Straßennetzes mit einer entsprechenden Ladeinfrastruktur (LIS) berücksichtigt werden. Während die Berechnung von Standorten und Potenzialen bei der LIS immer von bestimmten Annahmen abhängig ist, bietet das Planungswerkzeug die Möglichkeit, unterschiedliche Prämissen flexibel zu wählen und so dem jeweiligen Anwendungsfall Rechnung zu tragen.
AP 2: Geschäfts- und Betreibermodelle
Im Rahmen des Arbeitspaketes 2 werden Geschäfts- und Betreibermodelle für Schnellladestationen analysiert und weiterentwickelt. Die Frage, ob und wie mit dem Verkauf von Ladezeit bzw. Ladestrom aktuell und in Zukunft überhaupt ein valides Geschäftsmodell aufgezogen werden kann, wird im vorliegenden Arbeitspaket behandelt. Dazu wird u. a. auf die Erfahrungen der SLAM-Investoren und die Nutzungs- bzw. Ladedaten aus dem SLAM-Schnellladenetz zurückgegriffen.
Die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) hat bereits im Jahr 2015 dargestellt, dass mit dem Aufbau von Schnellladestandorten durchschnittlich sehr hohe Investitionskosten einhergehen. Ebenso kritisch sind jedoch die elementaren finanziellen Unterschiede bei ähnlich aufgebauten Standorten, insbesondere bei großen Lade-Hubs mit einer Vielzahl von leistungsintensiven Schnellladestationen (vgl. Abb. 1). Gerade die Themen Netzanbindung und Baukostenzuschuss, aber auch Tiefbau können die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Standorte gefährden.
Aktuelle Ladedaten (vgl. Abb. 2) der analysierten Standorte zeigen, dass – zumindest aktuell – für teure Standorte noch keine Möglichkeit zur Refinanzierung über den Verkauf von Ladestrom besteht. Bei dieser Momentaufnahme muss berücksichtigt werden, dass einige Standorte bereits für den zukünftigen Bedarf der Elektromobilität ausgelegt sind. So sind manche Schnellladestationen hochleistungsbefähigt, d.h. die Stromversorgung ist größer dimensioniert (und damit teurer) als es heutige Fahrzeuge erfordern würden.
Grundsätzlich haben sich alle in SLAM betrachteten Investoren hinsichtlich ihres Geschäftsmodelles weiterentwickelt. Marketingaspekte und der Verkauf von Ladestrom sind zwar weiterhin Bestandteil der Geschäftsmodelle, es gab jedoch in allen Bereichen evolutionäre Sprünge. Neben der Nutzung der Ladestation als Ergänzung zum Kerngeschäft, sind neue Aktivitäten entstanden, um das aufgebaute Know-How zu nutzen, bspw. mit neuen Contracting-Angeboten (vereinfacht gesagt: Trennung der Rolle des Investors von der Rolle des Betreibers). Aber auch die Entwicklung hin zum Mobilitätsanbieter, mit der Ladestation als Kristallisationspunkt, wurde beobachtet. Insgesamt gab es bei der grundsätzlichen Ausrichtung der Geschäftsmodelle kein richtig oder falsch, jedoch ist insbesondere die Tarifgestaltung ein Thema, das über eine beträchtliche Hebelwirkung verfügt. Eine abschließende Bewertung ist momentan noch nicht möglich, da die Marktdurchdringung der Elektrofahrzeuge insgesamt noch zu gering ist.
AP 3: Begleitende Nutzerstudie
QR-Code Befragung zur Nutzung einer Schnellladesäule
Nutzer eines Elektrofahrzeugs wurden im Rahmen einer begleitenden Nutzerstudie gebeten, während des Ladevorgangs an einer SLAM-Schnellladesäule einen fünfminütigen Kurzfragebogen zu beantworten. Dazu war ab Mai 2015 ein QR-Code-Aufkleber an der Schnellladesäule angebracht, der gescannt werden konnte und direkt auf die Seite der Befragung führte. Inhaltlich beschäftigte sich der Fragebogen u. a. mit dem Ort sowie dem Tag des Ladevorgangs, dem Start- und Zielort des Fahrers sowie dem Batteriestatus bei Ankunft an der Schnellladestation. Außerdem wurden die Nutzer der Säule gefragt, zu welchem Reisezweck sie unterwegs sind.
Onlinebefragung zum Wissen und Mehrwert von Schnellladeinfrastruktur
Zur Ermittlung des aktuellen Wissenstands und des wahrgenommenen Mehrwerts von Schnellladeinfrastruktur bei optimaler Positionierung wurde eine Onlinebefragung durchgeführt. Diese konnte von Juli 2015 bis März 2017 über eine Umfrageplattform abgerufen werden. Ein zugehöriger Link befand sich u. a. auf der Projekthomepage. Befragt wurden Nutzer eines Elektrofahrzeugs mit und ohne Schnellladefähigkeit sowie an der Elektromobilität interessierte Nichtnutzer (das Interesse der Nichtnutzer am Thema Elektromobilität wurde hierzu vorher abgefragt). Die Dauer der Befragung betrug etwa 30 Minuten. Insgesamt nahmen knapp 400 Personen an der Umfrage teil. Inhaltlich wurden die Befragten gebeten, mögliche Quellen anzugeben, welche sie zum Erhalt von Informationen zum Thema Schnellladen nutzen würden. Weiterhin sollten sie die durchschnittliche Ladedauer einer Schnellladung sowie den maximalen Batteriestatus nennen, bis zu dem eine Ladung mit Schnellladegeschwindigkeit technisch möglich ist. In einem letzten Schritt sollten die befragten Personen eine Aussage dazu machen, welchen Mehrwert in Prozent Schnellladeinfrastruktur bei optimaler Positionierung auf ihrer täglichen Wegstrecke im Hinblick auf das Nutzungspotenzial mit einem Elektrofahrzeug haben würde.
AP 4: Marktentwicklung und Bedarf zu eRoaming und Ad-hoc-Laden
Der Markthochlauf der Elektromobilität und die in diesem Zusammenhang wachsende Ladeinfrastruktur führten zu einer Vielzahl verschiedener Anbieter von öffentlichen Lademöglichkeiten. Möchte sich ein Kunde überregional bewegen, muss er sich daher bei Ladesäulen verschiedener Betreiber authentifizieren um bezahlen und anschließend laden zu können.
SLAM versteht sich als verbindendes Projekt im Leitmarkt Deutschland und verfolgt in diesem Zuge auch das Ziel der Harmonisierung unterschiedlicher Zugangs- und Abrechnungssysteme für das öffentliche Laden von Elektrofahrzeugen. Dafür wurden Nutzerschnittstellen und Abrechnungssysteme untersucht und nationale und internationale Partnerschnittstellen weiterentwickelt und zu harmonisieren versucht.
Die Themen „eRoaming“ und „Ad-hoc-Laden“ waren Kernbestandteile dieser Untersuchung, da sie die Möglichkeit einer kundenfreundlichen überregionalen Nutzung von Ladeinfrastruktur bieten. Mit dem „eRoaming“ werden Ladesäulen und Ladekartenanbieter in ein Netzwerk eingebunden, welches die Nutzung aller angeschlossenen Ladesäulen mit allen eingebundenen Ladekarten ermöglicht. Ist ein Ladevorgang außerhalb des Netzwerkes notwendig oder hat der Kunde keine RFID-Ladekarte oder passende App, so erhält er mit dem Ad-hoc-Laden dennoch die Möglichkeit, gegen sofortige Bezahlung zu laden.
SLAM bildet daher nicht nur die Brücke zwischen den Elektromobilitäts- und Schaufensterprojekten in Deutschland, sondern auch einen wesentlichen Baustein für Deutschland innerhalb der „Pan-European eRoaming Initiative“, welche die grenzüberschreitende Vereinheitlichung und Zusammenführung des eRoamings anstrebt.
Die Ergebnisse sind unter anderem in einer Informationsbroschüre zu Zugangs- und Abrechnungssystemen dargestellt, die Sie hier zum Download vorfinden: Übersicht Marktentwicklung und Bedarf zu eRoaming und Ad-hoc-Laden
AP 6: Energiemanagement von Schnellladestationen
Der Einsatz von Schnellladesäulen mit Leistungen >50 kW stellt eine neue Herausforderung für das Energiesystem dar. Im Gegensatz zu konventionellen Ladevorgängen mit niedrigen Leistungen, die zu einer gleichmäßiger über den Tag verteilten Last führen, kommt es zu sehr komprimierten, kurzen Ladezeiten mit hohen Leistungen. Insbesondere im Anschluss an Zeitpunkte mit hohen Verkehrsaufkommen (Stoßzeiten) kann die Stromlast stark durch die Elektrofahrzeugladung beeinflusst werden. In diesem Arbeitspaket werden deshalb die Auswirkungen von Schnellladevorgängen auf das Energiesystem untersucht. Dies umfasst zum einen die Analyse der Aufnahmefähigkeit der Verteilungsnetze und zum anderen die Untersuchungen der Auswirkungen auf den Kraftwerkseinsatz.
AP 6.1: Untersuchung der netzseitigen Auswirkungen des Schnellladens und der Anforderungen an das Netz der Zukunft
Zur Vermeidung von Überlastungen des Elektrizitätsverteilungsnetzes sind bei der Standortwahl lokal verfügbare Netzkapazitäten zu berücksichtigen. Das Institut für Hochspannungstechnik hat ein Simulationsverfahren entwickelt, mit dessen Hilfe u. a. verfügbare Netzkapazitäten bestimmt werden können. Mit Unterstützung der Netze BW GmbH und der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH konnte das Verfahren an Verteilungsnetzen von Stuttgart und dem Düsseldorfer Süden erprobt werden. Beide Städte weisen insgesamt ausreichend hohe Kapazitäten für Schnellladeinfrastruktur auf.
AP 6.2: Energiemanagement und Lastmanagement für Ladesäulen oder Stationen mit mehreren Ladesäulen und Integration von erneuerbaren Energien
Die Ladevorgänge der Elektrofahrzeuge haben eine Erhöhung der Stromlast zur Folge. Im Rahmen von SLAM werden die konkreten Auswirkungen dieser zusätzlichen Last untersucht. Dazu wird zunächst das Fahrverhalten der Elektrofahrzeuge simuliert und der Ladelastgang abgeleitet. Anschließend wird eine Simulation des Kraftwerkseinsatzes zur Deckung der Strombedarfe durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz von Schnellladesäulen selbst bei einer Durchdringung von 1.000.000 Elektrofahrzeugen nur geringe Auswirkungen auf den Kraftwerkseinsatz hat.
AP6.3 & 6.4: Technische Optimierung der Ladestation und prototypische Umsetzung eines Energie- / Lastmanagement
Um die Integration von Elektromobilität in ein Energiesystem möglichst effizient und klimaneutral zu gestalten, wurde im Parkhaus des Institutszentrum Stuttgart ein Micro Smart Grid aufgebaut, das neueste Technologien unter wissenschaftlicher Begleitung im Alltagsbetrieb demonstriert und als Grundlage für eigene Entwicklungen dient.
Die Anlage umfasst mit über 30 AC Ladestationen für Elektrofahrzeuge und zwei DC Schnellladesäulen mit einer Spitzenlast von über 500 kW eine der größten Ladeinfrastrukturen in einem Parkhaus. Der komplette Fahrstrom wird von einer Photovoltaikanlage produziert. Erzeugung und Verbrauch können dabei mit Hilfe eines Lithium-Ionen-Batteriespeichers optimal aufeinander abgestimmt werden. Mit dem europaweit ersten LOHC-Wasserstoffspeicher im Regelbetrieb kann Wasserstoff molekular in einem Trägeröl gebunden werden. Aufwändige Druckspeicher oder Kühlanlagen für Flüssigwasserstoff können somit entfallen. Mit 2.000 kWh stellt er im Micro Smart Grid einen Hochenergie- und Langzeitspeicher dar, der über eine Brennstoffzelle an die Stromversorgung angebunden ist. Die Komponenten des Micro Smart Grids werden über einen innovativen Gleichstromzwischenkreis energetisch angebunden und mittels selbst entwickelter intelligenter Steuerungen überwacht und betrieben. Somit ist es möglich, die Netzbelastung, die unter anderem durch die Schnellladestation entstehen kann, lokal zu reduzieren. Des Weiteren sind die Ladestationen dabei an das Dispositionsmanagementsystem »EcoGuru« angebunden, welches Fahrzeugbuchungen und Lademanagement optimal vereint. Mit einem übergeordneten Energiemanagementsystem werden Energieerzeuger, -speicher und -verbraucher aufeinander abgestimmt und hinsichtlich verschiedener Optimierungsziele gesteuert. Über Simulationsschnittstellen, dynamische Strompreismodelle und eine prognosebasierte Analagenführung können zukünftige Betreibermodelle schon heute in der Praxis evaluiert werden.
Im Zuge des Projektes SLAM wurde eine Schnellladesäule mit einer Ladeleistung von insgesamt 193 kWp in das Micro Smart Grid integriert. Selbstentwickelte Steuersysteme zur Spitzenlastbegrenzung glätten diese hohen Lasten und ermöglichen somit einen netzdienlichen Betrieb.
Um die Auswirkungen durch Schnellladen auf das Stromnetz und das Fahrzeug zu evaluieren, wurden Elektrofahrzeuge verschiedener Generationen getestet und ausgewertet. Um die Netzbelastung abzubilden, spielt die Leistungsspitze und der Leistungsverlauf eine entscheidende Rolle. Die Unterscheidung von Sommer- und Winterladungen ist dabei nicht zu vernachlässigen (vgl. Abb. 2 und 3). Weitere Auswertungen finden Sie in dem Paper „Göhler (2017): Technical Data Analysis and Power Grid Effects of Fast Charging Processes of Electric Vehicles”.
AP7: Aufbau des Forschungsladenetzwerkes
Um die Forschungsziele im Projekt SLAM zu erreichen, sind genaue Informationen von sehr vielen Schnellladepunkten notwendig. Daher wurde bzw. wird im Rahmen von SLAM ein deutschlandweites Schnellladenetz aufgebaut und beforscht (vgl. Abb. 1).
Ziel war und ist es, dieses Forschungsladenetz gemäß den wissenschaftlichen Fragestellungen bedarfsgerecht zu errichten. Daher ist das Arbeitspaket 7 „Aufbau des Forschungsladenetzwerkes“ Grundlage für jedes einzelne der wissenschaftlichen Arbeitspakete. Zum einen wird das Standortkonzept und Simulationstool (AP 1) für die Entscheidungen im Auswahlgremium zur Beurteilung der eingereichten Standortbewerbungen genutzt. Gleichzeitig helfen die aufgebauten Standorte, unter Zuhilfenahme der gewonnenen Ladedaten, das in SLAM entwickelte Simulationstool zu validieren. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand (AP 2) sind die Geschäftsmodelle der Investoren. Dafür werden getroffene Annahmen mit Hilfe der o. g. Ladedaten überprüft und das Nutzungsverhalten analysiert, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Somit wird der theoretische Rahmen verlassen und anhand realer Daten untersucht, welche Einflüsse die verschiedenen Unternehmungen positiv oder negativ verlaufen lassen. Darüber hinaus spielen Themen wie Zugang und Abrechnung, Preisgestaltung, Standortkriterien und Lage im Netzwerk eine zentrale Rolle.
Status Quo des Forschungsladenetzwerkes:
Aktuell sind 66 Standorte mit insgesamt 238 Schnellladepunkten von 10 SLAM-Investoren aufgebaut. Insbesondere die Standortsicherung an zentralen und achsnahen Hot Spots bleibt ein zeitaufwendiges Unterfangen (vgl. Abb. 2). Ebenso sind Genehmigungsverfahren und administrative Prozesse bei Ämtern und Behörden noch nicht eingespielt, sodass es z. T. zu unkalkulierbaren Verzögerungen kommt. Bis Mitte 2018 soll der Aufbau des Forschungsladenetzwerkes abgeschlossen sein, damit dann auch alle wissenschaftlichen Arbeiten erfolgreich zu Ende gebracht werden können.
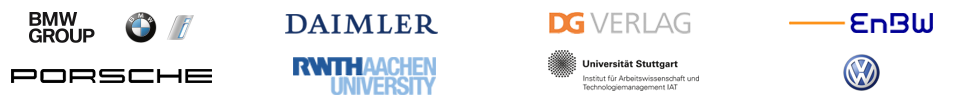
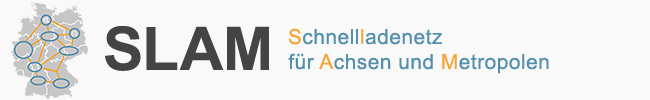

![[Logo: Schaufenster Elektromobilität]](images/schaufenster.png)